-
Nervensystem
und Bewegungsteuerung
- Jede zielgerichtete Bewegung ist eine koordinative Gesamtleistung des ZNS unter Führung des Großhirns.
- Die Bewegungsvorstellungen des Großhirns sind nur durch Mitwirkung untergeordneter ZNS-Einheiten in reale Bewegungen umzusetzen.
- Das Kleinhirn ist der Fertigkeitsspeicher für Sportbewegungen
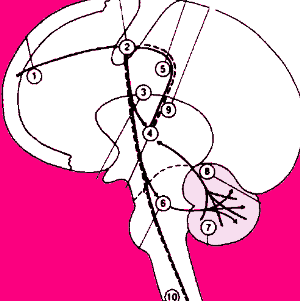 |
|
- Wenn
wir eine eine sportliche Bewegung ausführen, so ist es uns nur bedingt
möglich, alle Teilbewegungen bewusst zu kontrollieren. Aufgrund der
geringen Kapazität des Denkhirns (Großhirn) für Bewusstseinsprozesse
kann die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf nur sehr wenige Details einer
sportlichen Aktion gerichtet sein.
Beim
Tischtennisspielen wird uns bewusst sein, ob wir einen Unterschnitt- oder
Topspinball spielen. Was im Körper abläuft, ist dem Großhirn
- das die bewussten Vorgänge steuert - nicht bewusst.
Trotzdem
läuft bei geübten Spielern die Bewegung - dank der im Kleinhirn
gespeicherten Fertigkeiten (Bewegungsprogramme/Bewegungsentwürfe)
- ohne Fehlleistung ab. Alle Muskeln arbeiten koordiniert.
Das "Bewegungshirn" - bei schnellen Bewegungen vor allem das Kleinhirn - ist für die Feinarbeit der Muskeln bei der Bewegungssteuerung verantwortlich.
Die Lösung sportmotorischer Aufgaben erfolgt unter Führung des Großhirns ("Denkhirn") auf der Basis im Kleinhirn gespeicherter Fertigkeitsprogramme. Die Präzision der im Kleinhirn gespeicherten Programme hängt davon ab, wie umfangreich und intensiv eine Bewegung geübt bzw.trainiert worden ist. Geübte Sportler haben für die wichtigsten Bewegungsformen ihrer Sportart im Kleinhirn sehr exakt und zuverlässig arbeitende Programme gespeichert, ein Resultat jahrelangen Techniktrainings.
- Ablauf
| "Der
Entschluss zur Bewegung entsteht in den Assoziationsfeldern des Großhirns
(1).
Er enthält die Information, welche Körperteile die Bewegung ausführen sollen. Dieser Entschluss wird zu den sog. motorischen Feldern (Motorcortex) geleitet (2), die für alle Muskelpartien spezielle Nervenzellen besitzen. Diese Nervenzellen erteilen nun den für die Bewegung benötigten Bein-, Fuß-, Arm-, Handmuskeln usw. den Befehl, Kraft zu bilden (3). Allein aufgrund dieser Befehle würde jedoch die Bewegung nur sehr grob und unzureichend koordiniert ablaufen, wobei die Ungenauigkeit durch antreibende Impulse aus dem Zwischenhirn - ein Teil des Antriebs- und Empfindungshirns (Thalamus) - noch verstärkt wird (5). Gleichzeitig läuft der Rohbefehl auch über Querverbindungen in das Kleinhirn (6). Dort sind für alle geübten Bewegungen Programme gespeichert, die Informationen zur Feinkoordinierung der Muskelarbeit enthalten (7). Auf der Grundlage dieser Bewegungs(fertigkeits)programme dämpft das Kleinhirn mit hemmenden daß die Nervenzellen der motorischenFelder nur Befehle abgeben, die genau der vorgesehenen Bewegung entsprechen (9). Ein so durch das Kleinhirn modellierter Befehl läuft über das Rückenmark zu den Muskeln der beteiligten Glieder (10) und bewirkt schließlich, daß die Muskeln wohlabgestimmt - eben koordiniert - Kraft bilden." (Martin.u.a. S.66) |
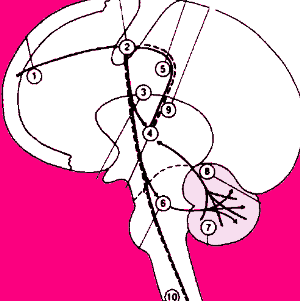
|
1 Assozationsfelder;
Entschluss zur Bewegung 2 Motorische Felder;
3 Rohbefehl an die Muskulatur 4 Zwischenhirn 5 Positive Zwischenmeldung vom Zwischenhirn zum Großhirn 6 Mittelhirn
7
8 Abgabe der Kleinhirnprogramme über hemmnende Bahnen 9 Hemmung des Rückkopplungskreises durch Kleinhirnbefehle 10 Rückenmark;
|
Das Kleinhirn
- Fertgkeitsspeicher für Sportbewegungen
Die
Fähigkeit,
zielgerichtete Bewegungen situationsangemessen zu koordinieren, ist das
Ergebnis von (sensomotorischen) Lernprozessen.
| "Sehr
vereinfachend skizziert wird aus psychologischer Sicht eine Bewegungsaufgabe
gelöst, indem nach Wahrnehmung einer zur Bewegung auffordernden Situation
und den damit verbundenen Motivationsprozessen eine Bewegungshandlung erfolgt.
Dabei hängt vor allem bei schnellen Bewegungen der Handlungserfolg
davon ab, inwieweit Teile einer Bewegungsfolge ohne Beteiligung des Bewußtseins
- gewissermaßen automatisch - ablaufen können. Demnach müssen
zur Lösung sportlicher Aufgaben Bewegungsautomatismen (Fertigkeiten)
verfügbar sein, deren Programme im "Unterbewußtsein" verankert
sind. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, daß
Programme für schnelle Bewegungen im Kleinhirn gespeichert werden.
Das Kleinhirn ist ein Organ, das in viele Rückmeldungssysteme eingebaut
ist und dadurch die sensomotorischen Programme kontrollieren kann. Bei
Versuchen, neue Bewegungstechniken zu erlernen, laufen aus den dem Kleinhirn
übergeordneten motorischen Zentren des Großhirns Impulse zu
den Motoneuronen im Rückenmark, um die geplante Bewegung auszulösen.
Die Bewegungsausführung wird dem Kleinhirn über die Kanäle
der Sinnesorgane rückgemeldet und falls Programmierungsfehler vorhanden
sind, greift das Kleinhirn ein, um die Leistung zu verbessern. Dieser Mechanismus
kommt aber bei schnellen Bewegungen zu spät und reicht nicht aus,
um die Kleinhirnfunktion bei schnellen und exakten Bewegungen zu erklären...
Bei der Koordination schneller, zielgerichteter Bewegungen ist das Kleinhirn bereits an der Programmierung beteiligt, wozu es durch die während der Lern- und Übungsprozesse gespeicherten Erfahrungen befähigt ist. Bei gekonnten Bewegungen entladen sich schon vor Beginn der Bewegung Kleinhirn-Neurone und beteiligen sich an der Modellierung des Endprogramms. Wenn also im Großhirn der Entschluß zur Bewegungsausführung entstanden ist, existiert ein äußerst rascher und zuverlässiger Informationswechsel zwischen Großhirn und Kleinhirn. |
Das
Großhirn kann keine Aktion in Gang setzen, ohne daß das Kleinhirn
sofort darüber Bescheid weiß. Es gibt keinen Zweifel darüber,
daß das Großhirn das Kommandozentrum ist, aber alle Instruktionen,
die es zu den Motoneuronen des Rückenmarks feuert, werden unmittelbar
in die gesamte Computermaschinerie der Kleinhirnrinde eingegeben. Es wird
angenommen, daß der Input in der Kleinhirnrinde unter Einsatz ihrer
Gedächtnisspeicher verarbeitet wird und nach weiterer Verarbeitung
in den Kleinhirnkernen zur gleichen motorischen Region des Großhirns
zurückgegeben wird (Eccles 1979, 168). Von Neurophysiologen wird heute
allgemein akzeptiert, daß intensive neuronale Aktivitäten Spuren
im ZNS hinterlassen, die sich zunächst in sog. dynamischen Engrammen
niederschlagen. Darunter versteht man eine neuronale Organisation im Gehirn,
die auf einer spezifischen Musterbildung von Impulsübertragungen beruht,
bis zu Stunden bestehen bleibt und nur kraft dieses anhaltenden strukturierten
Vorgangs existiert. Es wird davon ausgegangen, daß die an der Impulsmusterbildung
beteiligten Synapsen in der dynamischen Engrammzeit für Folgereize
besonders empfänglich sind. Für das Erlernen sporttechnischer
Bewegungsfertigkeiten ist es wichtig, daß zur Stabilisierung eines
als richtig bewerteten und damit speicherungswürdigen Bewegungsmusters
der nächste Versuch erfolgt, bevor das dynamische Engramm erloschen
ist. Dann nämlich "schleift" sich das Nervenimpulsmuster durch überdauernde
Veränderungen der beteiligten Synapsen ein und wird zum bleibenden
Engramm, psychologisch ausgedrückt: zum motorischen Gedächtnisbesitz."
(Martin u.a, S.68) |
Bewegungslehre Übersicht