
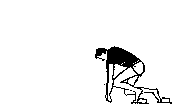
Typisches Schnelligkeitstraining
soll an zwei sportartspezifischen Beispielen dargestellt werden
(nach Martin u.a.):
Beispiel: Sprinttraining
Hier wird nur das spezielle
Schnelligkeitstraining, ohne Kraft-, Beweglichkeits- und Ausdaueranteile,
beschrieben. Es setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
- dem Beschleunigungs-
und Sprintschnelligkeitstraining
- dem Koordinationstraining
- dem Sprintausdauertraining
- dem Start- und Startbeschleunigungstraining
Beschleunigungs-
und Sprintschnelligkeit
Beschleunigungs- und Sprintschnelligkeit
werden komplex trainiert, weil die höchste Geschwindigkeit erst nach
einer Strecke von ca. 30 Metern erreicht werden kann. Allgemein wird die
Sprintstrecke in "Beschleunigungsphase", "Phase maximaler Geschwindigkeit"
und die "Phase absinkender Geschwindigkeit" eingeteilt. Die Phase bis zum
Erreichen der höchsten Geschwindigkeit (Beschleunigungsphase) dauert
etwa bis 30 m. Allerdings ist die Geschwindigkeitszunahme von 20 bis 30
m nur noch gering, so dass die eigentliche Beschleunigungsarbeit ca. 30
m in Anspruch nimmt.
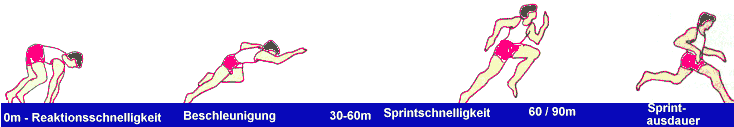
Beschleunigungssprints von
30 bis 40 m Länge eignen sich optimal für das Training der Kombination
"Beschleunigungs- und Sprintleistung". Diese Sprints müssen allerdings
unter optimalen, standardisierten äußeren Bedingungen durchgeführt
werden.
Belastungszeiten von ca.
5 Sekunden werden mit großer Wahrscheinlichkeit von der aerob-alaktaziden
Energiebereitstellung abgedeckt und führen deshalb kaum zu Laktatanhäufungen.
Zusammengefasst ergeben
sich demnach folgende Belastungskomponenten
für das Beschleunigungs- und Sprintschnelligkeitstraining:
Belastungsintensität:
100% mit höchster Willensanstrengung optimal zu beschleunigen und
die Strecke durchzulaufen.
Belastungsumfang:
2 Serien ä 8 x 30-40 m oder
1 Serie ä 10 x 30 m
und 1 Serie ä 5 x 40 m
Belastungsdichte:
Pausen zwischen den einzelnen Wiederholungen = 2 min Pause zwischen den
Serien > als 4 min.
Koordinationstraining
Das Koordinationstraining
soll die Sprintbewegung vor allem hinsichtlich der spinalen Verschaltungen
und des Zusammenspiels von Agonisten und Antagonisten
intermuskulär
besser koordinieren und die an der Sprintbewegung beteiligte Muskulatur
in übertriebene Dehnungszustände versetzen. Deshalb muss das
Koordinationstraining die folgenden Merkmale enthalten
- übertrieben ausholende Sprintbewegungen, um dabei eine größere Dehnleistung zu erzielen als bei der normalen Sprintbewegung
- so entspannt, spielend wie nur möglich zu laufen und dabei versuchen, an die Höchstgeschwindigkeit heranzukommen.
Bewährt haben sich hierfür Steigerungsläufe über 80 bis 100 m, bei denen die Geschwindigkeit bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit kontinuierlich gesteigert wird. Ferner Laufserien, bei denen auf Strecken von 60-80 Metern die Geschwindigkeit von Wiederholung zu Wiederholung gesteigert wird. Bewährt haben sich hier Vierer-Serien, bei denen die letzte Wiederholung mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit gelaufen wird. Die Zielsetzung ist die Verbesserung der intermuskulären Koordination.
Sprintausdauer (in Abgrenzung zur Schnelligkeitsausdauer) wird als die Fähigkeit betrachtet, Leistungen bis zu ca. 30 Sekunden mit Höchstintensität durchführen zu können. Bei diesen Leistungen sind weder der Laktatanstieg noch die Sauerstoffschuld die limitierenden Faktoren, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit das Nachlassen der differenzierten Steuerung der Bewegungsprogramme (wir bezeichnen diesen Zustand als Programmermüdung). Die Belastung erfolgt mit der höchsten Intensität und langen Erholungspausen.
Start und Startbeschleunigungstraining
Das
Training von einfachen Reaktionen, wie z. B. von Starts, hat zwei Komponenten:
-
das Einschleifen der Technik der Start- bzw. Reaktionsbewegung mit dem
Übergang zur Beschleunigungsphase,
-
Schulung der Zeitwahrnehmung.
Das
Starttraining ist ein gutes Beispiel für die Schulung der Antizipation,
denn hierbei muss gelernt werden, auf unterschiedliche Zeitintervalle zwischen
einer Vorankündigung/Vorbereitungsphase explosiv zu reagieren. Konzentration
( = sensorischer Anteil) und optimale Muskelvorspannung ( = motorischer
Anteil) der Reaktion müssen hierbei verbessert werden.
Schnelligkeitsleistungen
im Sportspiel
AB:
Schnelligikeitsleistungen
Bewegungslehre | Trainingslehre | Sportsoziologie/-psychologie